Weihnachten im Ferdinandihof 2025
Rückblick auf das Romantischen Weihnachtsfest, Freitag, 19. Dezember 2025 in der Sala Terrena im Ferdinandihof.
(Fotos: © Wolfgang Geißler, Wolfgang Buchta)
Von Wolfgang Geißler
Der Dezember legt sich über Wien wie ein leiser Filter.
Die Tage ziehen sich zurück, die Abende treten früher hervor, und zwischen Dämmerung und Laternenlicht verliert die Stadt ihre Schärfe. Geräusche sinken ab, Konturen lösen sich, Worte werden sparsamer. Man geht langsamer – nicht aus Müdigkeit, sondern aus Einverständnis mit der Jahreszeit.
An solchen Abenden liegt etwas Unausgesprochenes in der Luft: eine gespannte Ruhe, eine Erwartung ohne Ziel, vielleicht der Wunsch nach Nähe. Nach einem Ort, an dem man nicht erklären muss, warum man da ist. Man ist es einfach.
Der Weg führt durch vertraute Straßen, die jedes Jahr neu erscheinen. Nebel sammelt sich in den Höfen, haftet an Mauern, und hinter manchen Fenstern brennt bereits Kerzenlicht. Es ist jene Zeit, in der Wien nicht glänzen will, sondern wärmen.
Manche Orte tragen Erinnerung. Wer sie betritt, bringt mehr mit als Mantel und Uhrzeit. Zwei Abende haben sich hier bereits eingeschrieben: Kerzenlicht in der Sala Terrena, Stimmen, die sich mischten, ein Raum, der schneller voll war als erwartet. Ein Weihnachtsbaum, fast zu groß. Ein Kaminfeuer, das mehr tat, als nur zu heizen.
Einmal gemeinsames Singen – nicht ganz im Takt, aber mit Hingabe. Ein anderes Mal Musik, ruhig und getragen, die den Raum atmen ließ.
Es waren keine lauten Abende. Gerade deshalb blieben sie. Man stand beisammen, ein Glas in der Hand, wechselte Worte, die nicht wichtig sein mussten. Man lachte über kleine Rituale, über vertraute Reden, über Zahlen, die jedes Jahr wiederkehrten und doch nie ganz gleich klangen. Nichts Spektakuläres – und genau darin lag ihr Reiz.
Wer sich heute auf den Weg macht, trägt all das mit. Nicht als Vergleich, nicht als Erwartung, sondern als Gewissheit: Ein Abend darf gelingen, ohne sich beweisen zu müssen.
Dann öffnet sich, beinahe beiläufig, ein Tor.
Der Trubel der Stadt bleibt zurück, als hätte man ihn bewusst abgelegt. Schritte klingen gedämpfter, Stimmen senken sich von selbst. Der Hof liegt da wie ein stiller Empfang: geschlossen, geschützt, aus der Zeit gefallen. Kopfsteinpflaster, Mauern mit Geschichte, ein Ort, der nichts fordert und gerade dadurch einlädt.
Man bleibt einen Moment stehen. Nicht aus Unsicherheit, sondern weil es guttut. Weil man spürt: Hier darf der Abend werden, was er will.
Hier endet der Weg nach draußen. Hier beginnt das Zusammensein.
Im Ferdinandihof.
Man hatte Platz genommen, Gläser klangen leise aneinander, Gespräche ebbten ab, ohne dass jemand darum gebeten hätte. Der Raum wurde still – nicht aus Pflicht, sondern aus Aufmerksamkeit.
Dann trat der Präsident nach vorne. Kein Pathos, kein erhobener Zeigefinger. Eher ein kurzes Innehalten. Kurt Tiroch begann mit einem Thema, das überraschte und gerade deshalb fesselte. Er nannte es: „Das Sandkorn, der Stern, die Zeit.“
Er sprach vom Sand, von der Sahara, die er vor über vierzig Jahren selbst durchquert hatte, von unzähligen Sandkörnern, deren Anzahl jede Vorstellung sprengt. Von Atomen, aus denen jedes einzelne besteht, von Zahlen, die so groß sind, dass sie aufhören, Zahlen zu sein.
Von dort führte er den Blick nach oben – zu den Sternen, zu den unfassbaren Dimensionen des Universums. Und schließlich zur Zeit: zur langen Zeit der Erde, zur Begrenztheit unseres eigenen Lebens innerhalb dieses gewaltigen Rahmens.
Aus dieser Perspektive schlug er den Bogen zurück zu uns. Vielleicht, so seine leise Provokation, täte es uns gut, uns manchmal als das zu sehen, was wir im großen Zusammenhang sind: ein Sandkorn. Nicht wertlos, aber auch nicht so wichtig, wie wir es im Alltag oft glauben.
Gerade darin liege eine Befreiung. Man müsse nicht alles kontrollieren, nicht alles beschleunigen. Man dürfe ruhiger werden, gelassener, großzügiger mit sich selbst. Besonders jetzt, in der Weihnachtszeit – für Familie, Freunde und jene Momente, in denen nichts „erledigt“ werden muss.
Er dankte Vorstand, Firmenmitgliedern, Sponsoren und nicht zuletzt den Mitgliedern selbst. Engagement ja – aber ohne Selbstüberhöhung. Aktiv sein, ohne sich zu verlieren. Mit dem Wunsch nach Zeit, Auszeit und Maß schloss er seine Rede.
Der Applaus war dicht und ruhig. Ein Zeichen dafür, dass diese Worte nicht nur gehört, sondern angenommen worden waren.
Dann änderte der Abend seinen Rhythmus.
Lia & Rob – Duo Melody erwiesen sich als wahrhaftiges und großartiges Plus. Mit Musik und Gesang lösten sie das Denken in Bewegung auf. Lia schlängelte sich singend mit ihrem Mikrofon durch die Menge, ganz nah bei den Gästen. Bald wurde mitgewippt, dann getanzt – inklusive des Autors.
Und natürlich blieb an diesem Abend niemand durstig oder hungrig.
Unzählige Flaschen Sekt – so zahlreich wie Sandkörner in der Wüste oder Sterne im Universum – wurden geöffnet, fleißig serviert und immer wieder nachgefüllt. Dazu herrliche Brötchen, Tablett um Tablett, scheinbar ohne Ende. All das courtesy unseres Café-Ministeriums, das einmal mehr bewies, dass Gastfreundschaft eine leise, aber tragende Kunst ist.
So blieb von diesem Abend mehr als ein schönes Ereignis. Er blieb als Haltung.
Als Erinnerung daran, dass Größe nicht in Lautstärke liegt, sondern im Maß. Dass man denken darf, ohne sich zu verlieren. Feiern darf, ohne sich zu überheben. Dass man Teil eines großen Ganzen sein kann – und gerade deshalb im Kleinen ganz bei sich.
Man ging nicht mit Antworten nach Hause, sondern mit Bildern: dem Sandkorn, dem Stern, der Zeit. Mit Musik im Ohr, mit Wärme im Körper, mit dem Gefühl, gut aufgehoben gewesen zu sein.
Der Ferdinandihof hatte gehalten, was er versprach. Nicht als Bühne, sondern als Raum. Ein Raum für Begegnung, für Gedanken, für Bewegung, für Genuss.
Und vielleicht lag genau darin der Kern dieses Abends: nicht im Einzelnen, sondern im Zusammenspiel. Nicht im Höhepunkt, sondern im Nachklang.
Ein Abend, der nichts beweisen wollte. Der nicht drängte, nicht überhöhte, nicht festhielt.
Und der gerade deshalb blieb.
***




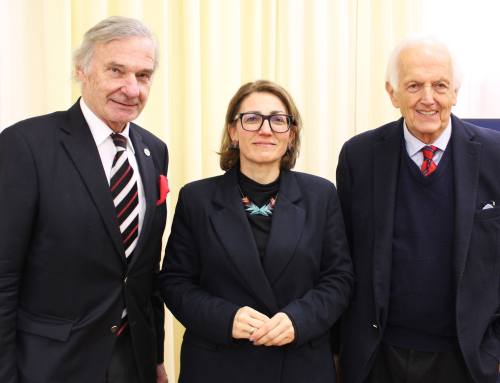


Lieber Wolfgang Geißler, vielen Dank für die tiefempfundenen und treffenden Zeilen zum Ablauf des überaus gelungenen ABS-Weihnachtsfestes.
Herzlichst
Renate und Heinz